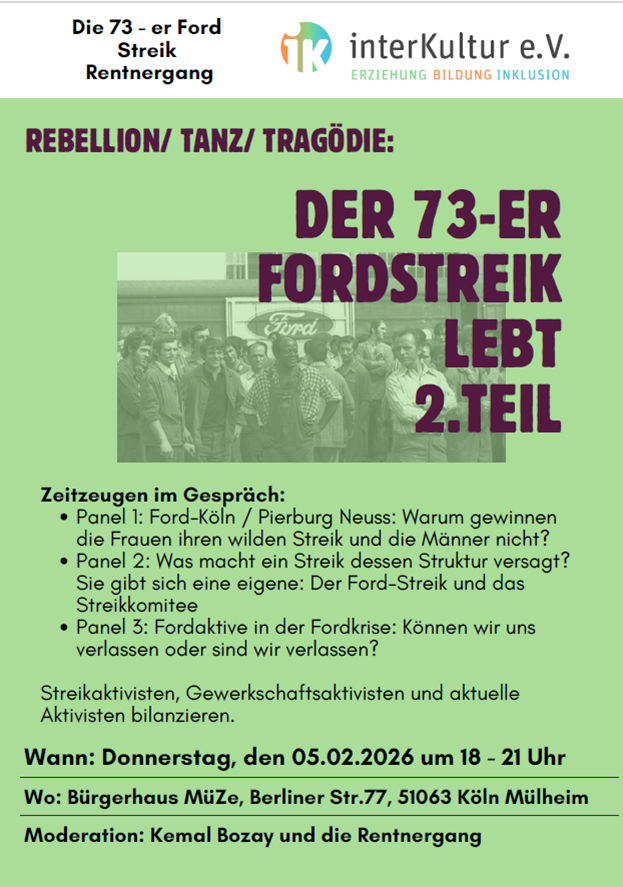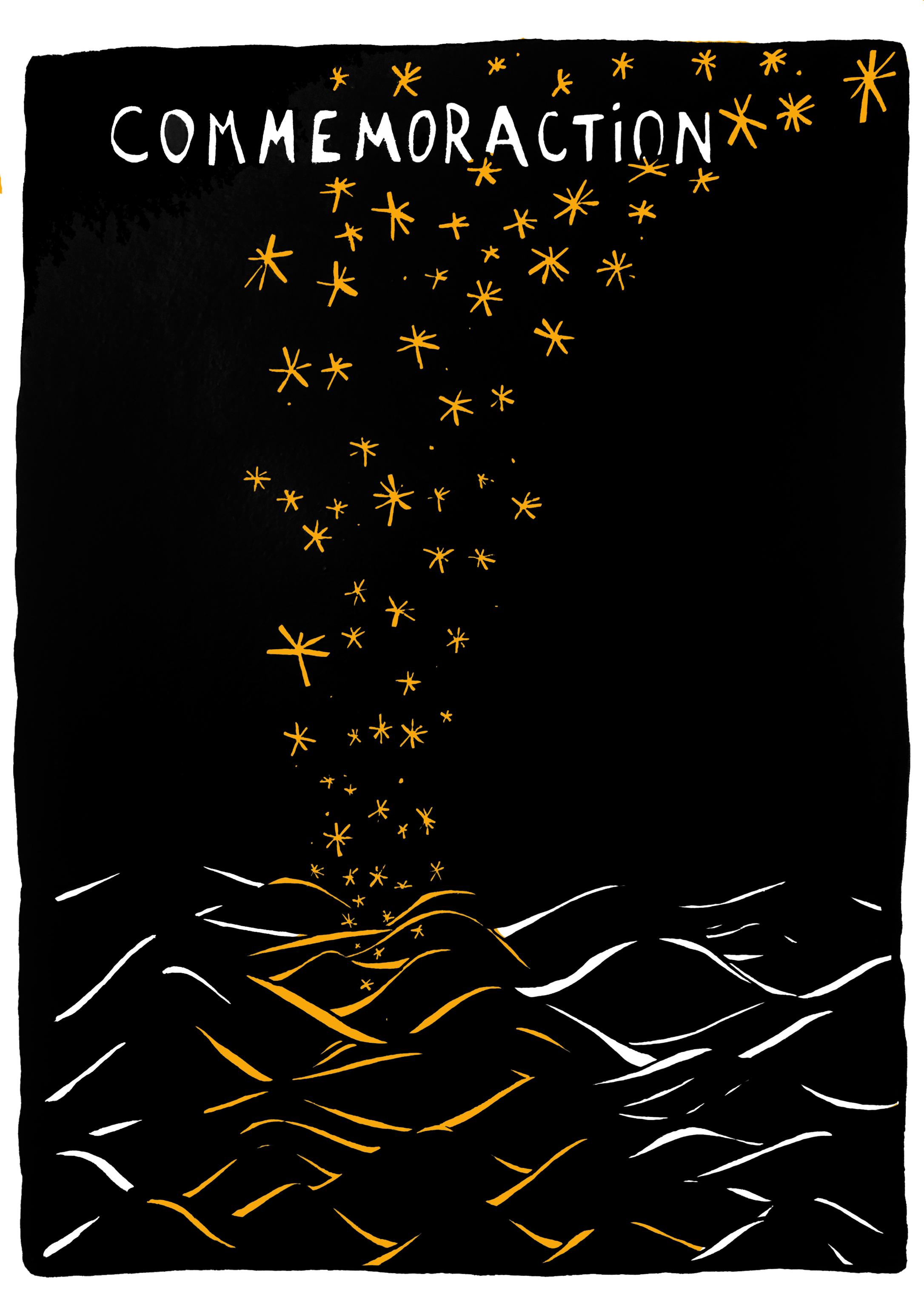Semiya Şimşek, Gamze Kubaşık sowie Mandy und Michalina Boulgarides hegen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Ausstiegs der Rechtsterroristin Z. aus der rechten Szene und wenden sich mit einer Petition an das Aussteigerprogramm „EXIT“ sowie an die Bundesregierung. „Zu einem glaubhaften Ausstieg gehören die Offenlegung von sämtlichen Täterinnen-Wissen gegenüber uns Betroffenen, unseren Anwält*innen und den Strafverfolgungsbehörden. Hinterzimmer-Gespräche mit Ermittlungsbehörden und Verfassungsschutz seien kein Nachweis eines Ausstiegs“, schreiben die vier engagierten Hinterbliebenen in dem Statement zu ihrer Petition, in dem sie ein transparentes Verfahren und den Ausstieg von Z. aus dem Verfahren fordern. Das Aussteigerprogramm Sachsen hatte vor zwei Jahren einen Aufnahmeantrag der in der JVA Chemnitz Inhaftierten abgelehnt.
Im Juli 2018 war die Mitgründerin des NSU wegen ihrer Beteiligung an der zehnfachen Mordserie, zwei Sprengstoffanschlägen in Köln und vierzehn Raubüberfällen sowie wegen Brandstiftung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden. Nach 15 Jahren Haft entscheidet das Oberlandesgericht München spätestens im November 2026 über die endgültige Dauer der Strafe und eine frühere Entlassung. Ob die Teilnahme an dem Aussteigerprogramm dabei von Bedeutung sein wird, ist politisch belanglos. Entscheidend ist, worauf Seda Başay-Yildiz, die Nebenklagevertreterin der Familie Şimşek, bereits nach dem Münchner Urteil hingewiesen hat: Die Weigerung der Angeklagten, Verantwortung für ihre Verbrechen zu übernehmen. Das gilt im Übrigen für alle Akteure im NSU-Komplex – auch für die Polizei und Justiz sowie den Verfassungsschutz.
Die landläufige Vorstellung, die Staatsmacht sei auf dem rechten Auge blind, erwies sich als naiv. Tatsächlich war die V-Mann-Strategie des Verfassungsschutzes erfolgreich. Durch den Aufbau von angeworbenen Kadern erlangte der Geheimdienst maßgeblichen Einfluss auf die rechte Szene. Der Inlandsgeheimdienst hatte auch die so genannte Thüringer Heimatfront, aus der die späteren NSU-Terroristen kamen, mithilfe von V-Leuten maßgeblich aufgebaut und gesteuert. Wie weit der Verfassungsschutz sich dabei mit Nazi-Terroristen gemein machte und wie wenig er sich an Rechtsstaatlichkeit hält, zeigte sich unter anderem am Mord Halit Yozgats. Nach der Tat wurde ein Mann verdächtigt, der während des Mordes am Tatort war; alsbald wurde er als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes entlarvt. Ob der Beamte Mörder oder Zuschauer war, gehört zu den am besten gehüteten Geheimnissen dieser Republik. Nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 ließ ein Referatsleiter des Bundesamts für Verfassungsschutz wohlweislich die Akten von sieben V-Leuten aus der Thüringer Neonazi-Szene vernichten. Die NSU-Akten im Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Hessen mit Bezügen zum NSU wurden 2012 kurzerhand mit einem Sperrvermerk versehen und für 120 Jahre als geheim eingestuft. Als das bekannt wurde, wurde diese Frist auf 30 Jahre verringert.
Obwohl das Münchner Gericht bei der Strafzumessung im NSU-Prozess die Frage nach den von den Tätern verschuldeten Auswirkungen der Taten nach Paragraf 46 des Strafgesetzbuches hätte klären müssen, hat die Kammer sich erst gar nicht mit den Folgen für die Angehörigen beschäftigt. „Die von mir vertretene Adile Şimşek, die Ehefrau von Enver Şimşek, dem ersten Mordopfer des NSU, wusste über zehn Jahre nicht, wer ihren Mann umgebracht hatte. Sie verfiel in schwere Depressionen“, sagte Basay-Yildiz. Es sei zutiefst beschämend und unanständig, dass sichauf den 3025 Seiten des Urteils kein einziger Satz dazu findet. Diese Ignoranz gegenüber den Betroffenen ist Ausdruck eines tiefsitzenden institutionellen Rassismus der Sicherheitsbehörden. Das Sprechen über Rassismus bei Polizei und Justiz führt bis heute zu reflexhaften Abwehrreaktionen. Dabei verlaufen die Ermittlungen im Kontext rechter Gewalt immer nach demselben Muster: Die Opfer werden zu Tätern gemacht, Hinweise auf Nazis als Täter, ein rassistisches Motiv nicht ernst genommen und entsprechende Spuren nicht verfolgt. Dasselbe gilt für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Rassismus bei der Polizei? Nein! Notwehr? Ja, sicher. Die verantwortlichen Polizisten müssen sich in den meisten Fällen gar nicht dafür vor Gericht verantworten. Wenn doch, kommen sie in der Regel mit einer geringen Strafe davon, die für die keine beruflichen Konsequenzen hat, wie im Fall Mohamed Dramé‘ in Dortmund.
Es ist Semiya Şimşek, Mandy und Michalina Boulgarides, Gamze Kubaşık zu verdanken, dass die vorzeitige Haftentlassung der Naziterroristin nicht völlig geräuschlos erfolgt, und sie gemeinsam mit Seda Basay-Yildiz und Barbara John, Angela Merkels Parteifreundin und Ombudsfrau für die Betroffenen des NSU, öffentlich das Wort ergreifen. Mit der Aufnahme in das Aussteigerprogramm bereite Z. nur ihre vorzeitige Haftentlassung vor, kritisiert John. Obwohl es noch keine gesetzliche Regelung dafür gibt, fordert John, dass die Angehörigen der Ermordeten an der Entscheidung über ein mögliches frühzeitiges Haftende zu beteiligen sind. Die große Diskrepanz zwischen Ankündigungen der Politik nach „lückenloser Aufklärung“ (A. Merkel 2011) und der Realität ist offensichtlich. Auch 25 Jahre nach dem Mord an Enver Şimşek haben die Behörden keine Konsequenzen aus dem NSU-Komplex gezogen.
Semiya Şimşek, Gamze Kubaşık sowie Mandy und Michalina Boulgarides machen in ihrer Petition noch auf einen anderen Missstand aufmerksam: Opfer von (Gewalt-)Verbrechen haben zwar einen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung, werden aber in vielen Fällen nicht als Opfer anerkannt, etwa als Schwestern oder Brüder von Ermordeten. Außerdem sind sie mit einer Bürokratie konfrontiert, die ihnen ihre Ansprüche abspricht und immer wieder Nachweise ihrer Traumatisierung abverlangt, eine entwürdigende Prozedur. Die Sachbearbeiter*innen sind in der Regel weiß, privilegiert und empfinden keine Empathie für das Leid der Betroffenen. Betroffene sind es leid, permanent um ihre Ansprüche kämpfen zu müssen. Das ist aufreibend und ihnen nicht zuzumuten. Entschädigung und Opferrenten gehören deshalb auf die Tagesordnung.
25 Jahre nach dem Mord an Enver Şimşek gibt es Grund zur Hoffnung. Während die Betroffenen sich kurz nach den Morden an Halit Yozgat und Mehmet Kubaşık nur auf ihre Community verlassen konnten und mit Tausenden in Kassel und Dortmund für „Kein 10. Opfer“ demonstrierten, blieben sie von der (linken) Öffentlichkeit noch unbeachtet. Heute sind die Betroffenen rassistischer und antisemitischer Gewalt bundesweit vernetzt und finden Gehör in der Öffentlichkeit. Auch wenn sich Polizei und Justiz hinter ihren Mauern verschanzen, der Corpsgeist ungebrochen ist, manche Viertel mit Kameras und massiver Polizei-Präsenz überwacht und regelrecht belagert werden, rassistische Polizeikontrollen alltäglich sind, regt sich Kritik. Polizei und Justiz haben ein Rassismus-Problem. Und heute weiß jedes Kind, dass Razzien und Leibesvisitationen entwürdigende Praxen der Behörden sind. Wenn heute eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation von der Polizei erschossen wird oder in der Haft stirbt, lässt das Menschen aufhorchen; Betroffene von rassistischer und antisemitischer Gewalt finden solidarische Menschen und Strukturen, die Unterstützung anbieten. Die Namen der Ermordeten sind inzwischen Synonyme für den Widerstand gegen Rassismus und Polizeigewalt, wie der von Lorenz, der Ostern 2025 in Oldenburg von einem Polizisten von hinten erschossen wurde. Ein paar Tage später versammelten sich Tausende und trugen ihre Wut auf die Straße.
Am 17. Oktober 2025 haben Semiya Şimşek, Mandy und Michalina Boulgarides, Gamze Kubaşık in Berlin die Petition mit den Unterschriften von 150.238 Menschen an Abgeordnete des Deutschen Bundestags übergeben.
(mr)