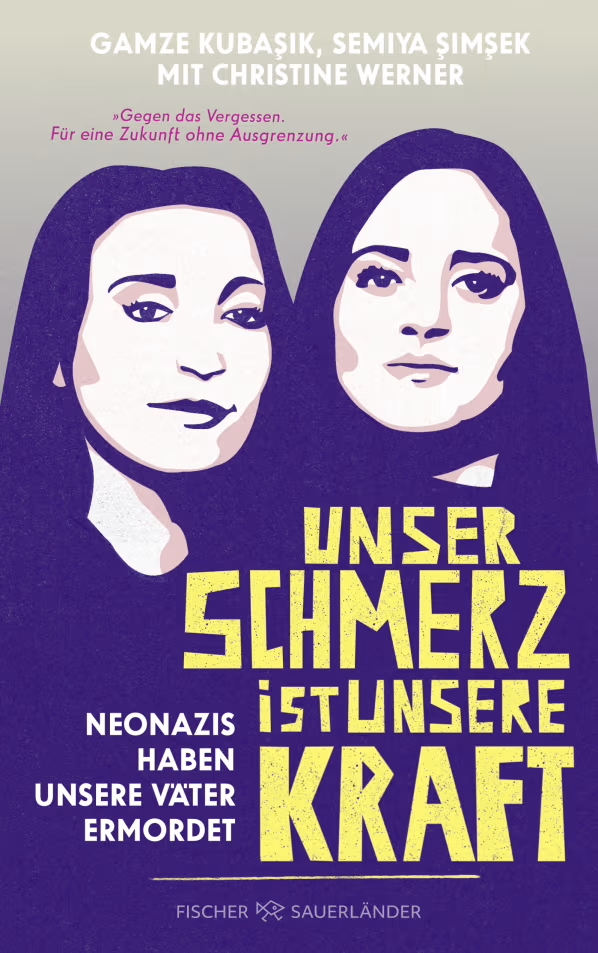Das Landgericht Dortmund sieht kein schuldhaftes Verhalten bei den Dortmunder Polizist*innen, die für den Tod des jungen Senegalesen Mouhamed Dramé verantwortlich sind. Das Gericht stützt damit die Polizeibehörden und das Innenministerium NRW, die die tödlichen Schüsse mit einer angeblichen Notwehrsituation der Polizist*innen gerechtfertigt hatten. Zur Begründung für dieses skandalöse Urteil zieht das Gericht den so genannten Erlaubnistatbestandsirrtum heran. Mit diesem juristischen Konstrukt verneint das Gericht eine individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit der handelnden Beamt*innen, obwohl es als Ergebnis der Beweisaufnahme eine „verhängnisvolle polizeiliche Fehleinschätzung“ festgestellt hatte und „der Einsatz aus strafrechtlicher Sicht mindestens in Teilen rechtswidrig war“, so Tobias Singelnstein, Hannah Espín Grau und Laila Abdul-Rahman in einem Beitrag für https://www.lto.de/.lto.de. Konsequenzen dieses fatalen Fehlverhaltens? Fehlanzeige!
Mouhamed Dramé war gerade Mal sechzehn Jahre alt, als er im August 2022 bei einem Polizeieinsatz im Innenhof einer Dortmunder Jugendhilfeeinrichtung getötet wurde. Er hatte sich erst kurz zuvor hilfesuchend in deren Obhut begeben. Das Pflegepersonal rief die Polizei, weil der suizidgefährdete Jugendliche am Boden sitzend mit einem Messer in der Hand sich selbst zu verletzen drohte. Nach dem Einsatz von Pfefferspray soll er sich mit dem Messer in der Hand auf die Beamten zubewegt haben, was die Beamten nach ihren Aussagen als bedrohlich wahrnahmen. Doch einen anderen Ausweg aus der Nische, in der er zuvor mit Pfefferspray attackiert worden war, gab es nicht und die Beamten setzten Taser und eine Maschinenpistole ein. Mouhamed Dramé wurde von 5 Schüssen getroffen. Eine verhängnisvolle Verkettung tragischer Umstände für die niemand etwas kann?
Im Gerichtssaal kam es nach der Urteilsverkündung zu lautstarken Protesten. Aktivist*innen skandierten „Justice for Mouhamed – Das war Mord“. Die Brüder des Getöteten, Sidy und Lasanna Dramé, zeigten sich tief enttäuscht. „Wir haben den Kampf verloren“, sagte Sidy gegenüber einem WDR-Reporter. Er schäme sich für den Richter und fragt: "Das soll Gerechtigkeit sein?" Tatsächlich ist das Urteil ein Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen aus dem Senegal, die als Nebenkläger vor Gericht aufgetreten waren und Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen fordern. Die Freisprüche für die Beamten sind aber auch eine Kampfansage an die solidarischen Initiativen, die den Prozess beobachtet haben und unermüdlich auf die Hintergründe des verhängnisvollen Einsatzes von Gewalt gegenüber einem Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation hingewiesen haben. „Der Urteilsspruch zeigt nur, wie kaputt das System ist“, meinte eine Prozessbeobachterin am Rande der Demonstration am Samstag nach der Urteilsverkündig in der Dortmunder Nordstadt und brachte so auf den Punkt, was viele der mehr als zweitausend Menschen empfanden, die ihre Empörung über den Urteilsspruch zum Ausdruck brachten.
Keine Empathie, kein Bedauern des Gerichts
Die Ausführungen des Vorsitzenden Richters, Thomas Kelm, waren für die Hinterbliebenen und die meisten Prozessbeobachter*innen kaum zu ertragen: Kein Wort an die Angehörigen, keinerlei Empathie, kein Wort des Bedauerns über den Tod von Mouhamed Dramé. Stattdessen eiskalte, zynische Ausführungen. Über den 16-Jährigen sagte der Richter nur, „die Erwartungen, die er mit seiner Reise nach Europa verbunden hatte, haben sich nicht erfüllt.“ Zur Begründunge für den Freispruch des Schützen führte er aus: Die Schussabgabe sei erforderlich gewesen, andere Mittel nicht erreichbar. Der sofortige Einsatz sei zwingend gewesen. „Es war das einzige Abwehrmittel. Gebotenheit haben wir auch. Wir erkennen hier keine Einschränkung der Notwehr. Die Nähe war aufgrund des Einsatzplans vorgegeben. Es war klar, der musste dahinlaufen.“ Auch die 6 Schüsse seien gedeckt (gerechtfertigt)– „der Angriff ist erst beendet, wenn der Täter [tatsächlich das Opfer] zu Boden geht.“ Alles das sei für die Kammer nachvollziehbar. „Es wurde auch nicht länger geschossen als bis der Dramé zu Boden gegangen sei.“ Damit sei in der Situation eine Notwehrlage vorgestellt. Hier handele es sich um einen Tatbestandsirrtum, nach BGH und auch nach der geltenden Lehre – eine Bestrafung wegen Vorsatztat sei nicht möglich. Auch beim Einsatzleiter sah das Gericht keinen Fehler und keine Pflichtverletzung. Das sofortige Einschreiten sei nachvollziehbar gewesen, sagte der Vorsitzende. Die Beamten sollten den 16-Jährigen entwaffnen, weil die Gefahr bestanden habe, dass er sich das Leben nimmt. Es sei auch darum gegangen, dass unbeteiligte Dritte nicht gefährdet werden. Auch wenn heute im Rückblick klar sei, dass der 16-Jährige dies nicht vorhatte. „Nachher ist man immer schlauer, besonders, wenn man im Gerichtssaal sitzt“, sagte Kelm zum Abschluss lapidar. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer dem Einsatzleiter fahrlässige Tötung vorgeworfen und eine Haftstrafe auf Bewährung gefordert. Er habe zu Unrecht und zu unüberlegt den Einsatz von Pfefferspray angeordnet - und so den fatalen Lauf der Dinge erst in Gang gesetzt. Das Gericht kam zu einem anderen Urteil.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Vertreterin der Nebenklage kündigte Revision an. Die Staatsanwaltschaft legte Rechtsmittel gegen den Freispruch des Einsatzleiters ein.
Die Kultur der Straflosigkeit
Die Gewerkschaft der Polizei feierte den Freispruch ihrer Kolleg*innen: „Die gleich zu Beginn in den Raum geworfenen Vorwürfe, eines rassistischen Hintergrundes, (seien) ganz eindeutig widerlegt (…) Für die Zukunft wünsche ich mir, dass für alle Einsatzkräfte zunächst die Unschuldsvermutung gilt“, äußert die Vorsitzende der GdP Kreisgruppe Dortmund und drückt so ihre unverhohlene Empörung darüber aus, dass ihre Kolleginnen sich überhaupt vor Gericht für die Todesschüsse verantworten mussten. „Dieser Mensch versieht seinen Dienst nicht um einem anderen das Leben zu nehmen, sondern um die Rechte und Gesetze unseres Rechtsstaates zu schützen“, meint die Gewerkschafterin.
Tatsächlich gibt es bei den Verdachtsfällen rechtswidriger polizeilicher Gewaltanwendung, die den Staatsanwaltschaften überhaupt bekannt werden eine „äußerst niedrige Anklagequote von etwa 2 % (durchschnittliche Quote aller Ermittlungsverfahren: 22 %) sowie eine sehr hohe Einstellungsquote“, schreiben Laila Abdul-Rahman, Hannah Espín Grau, Luise Klaus und Tobias Singelnstein in ihrer Studie »Gewalt im Amt«. 2021 wurden demnach 93 Prozent der abschließend erledigten Strafverfahren gegen Polizeibeamt*innen wegen rechtswidriger Gewaltausübung mangels hinreichenden Tatverdachts nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt. In 4 Prozent stellten die Staatsanwaltschaften die Verfahren trotz hinreichenden Tatverdachts gegen die Polizeibeamtinnen gegen Auflagen oder wegen Geringfügigkeit ein. 2021 wurden von 80 angeklagten Beamtinnen lediglich 27 schuldig gesprochen – eine Verurteilungsquote von 34 Prozent, in anderen Strafverfahren liegt diese bei 81 Prozent.
Polizei hat die Ausnahmesituation durch den Einsatz von Gewalt erst verursacht
Der Polizeieinsätze gegen Mouhamed Dramé sein ein Bespiel, dass Polizeigewalt eine Gefahrensituation im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen erst herstellen bzw. verschärfen, schreiben die oben zitierten Kriminolog*innen. Der Einsatz von Pfefferspray verstärke die Bedrohungswahrnehmung der Betroffenen, führe oft zu Panik, „die die Situation dynamisiert und eskalieren lässt. Dass Polizeieinsätze für Menschen in psychischen Ausnahmesituationen auf diese Weise tödlich enden, ist kein Einzelfall. Offizielle Statistiken fehlen, doch Schätzungen zufolge befinden sich Dreiviertel aller von der Polizei Getöteten Menschen in einer solch krisenhaften Situation.“
Die empirische Polizeiforschung hat gezeigt, dass derartige Umstände die Wahrnehmung und Einschätzung von Situationen und ihrer Gefährlichkeit und damit die polizeiliche Gefahrenprognose beeinflussen können – unabhängig von der Gefahrenlage in der konkreten Situation. Selbst die Entscheidung für einen Schusswaffeneinsatz kann hierdurch beeinflusst sein, wie Studien zeigen – und zwar auch unbewusst, ohne dass rassistische Motive verfolgt werden müssen (sog. shooter bias). Vor diesem Hintergrund erscheint es mindestens plausibel, dass etwa die gesellschaftlichen Debatten um einen Anstieg von Straftaten mit Messern, rassistische Stereotype über die vermeintliche Impulsivität Schwarzer junger Männer und die polizeilichen Kategorisierungen bezüglich der Dortmunder Nordstadt als Einsatzort zu einer spezifischen Gefahreneinschätzung beigetragen haben.
Studien zeigten außerdem, dass die Gefährlichkeit von Menschen mit psychischen Erkrankungen aufgrund ihrer Stigmatisierung in der Gesellschaft überschätzt wird. Unreflektierte Vorannahmen über Einsatzkontexte und rassistisch markierte Personen, mit denen die Polizei interagiert, können insofern zu eskalierenden oder gar tödlichen Einsätzen führen.
„Derartigen dehumanisierenden Gefahrennarrativen scheint im Fall Dramé auch das Gericht zu folgen, das den massiven Pfeffersprayeinsatz und damit die tatbestandliche gefährliche Körperverletzung des hilfebedürftigen jungen Mannes – trotz mangelnder situativer Anhaltspunkte – als nachvollziehbar erachtete. Dabei hatte die Staatsanwaltschaft festgestellt, dass eine Flucht aus der Nische faktisch nicht möglich war. Eine konkrete Gefährdung von unbeteiligten Dritten bestand also nicht“, schreiben die kritischen Kriminolog*innen.
Dortmunder Initiativen fordern Abschaffung der Wache Nord
Die Nebenklagevertretung und die solidarischen Initiativen haben immer wieder auf die besondere Konstellation des Einsatzes und deren mögliche Auswirkungen auf die Gefahrenwahrnehmungen der eingesetzten Beamtinnen hingewiesen: Mouhamed Dramé war nicht weiß, er war schwarz, kam aus dem Senegal, befand sich in einer akuten psychischen Ausnahmesituation, er hatte ein Messer dabei und der Einsatz erfolgte in der Dortmunder Nordstadt. Die an dem tödlichen Einsatz beteiligten Beamt*innen gehören zur berüchtigten Wache Nord. Die Nordwache hat seit Jahren ein strukturelles Problem mit Polizeigewalt, Rassismus und Sexismus. Dass Polizeigewalt tödlich endet, ist auch in Dortmund kein “Einzelfall. 2012 starb der in der Nordstadt wohnende Ousman Sey, ein 45-jähriger Mann aus Gambia, im Polizeigewahrsam. Die Umstände sind ungeklärt, die Ermittlungen wurden nach neun Monaten eingestellt. Ousman Sey war krank, hatte zweimal den Rettungsdienst gerufen, aber der wollte keine Notlage erkannt haben. Als sie ihn nicht in die Klinik brachten, erfasste Ousman Sey Panik. Die Rettungskräfte riefen die Bereitschaftspolizei, die ihn gefesselt ins Präsidium transportierten. Bevor dort ein Polizeiarzt eintraf, war der Mann tödlich zusammengebrochen.
Im Sommer 2022 tauchten in der Dortmunder Nordstadt Plakate mit dem Hinweis auf “Achtung Revier der Nordwache – Hier herrscht Polizeigewalt, Rassismus und Sexismus”. Kurz zuvor hatte der WDR über zwei Frauen berichtet, die unabhängig voneinander schwere Vorwürfe gegen Polizeibeamte der Wache Nord, auf Grund von Schlägen und sexistischen Beleidigungen erhoben haben. Es sei keine Seltenheit, dass migrantisierte Menschen die Wache mit erheblichen Hämatomen verlassen oder sich Beleidigungen und Erniedrigungen aussetzen müssen. In den umliegenden Krankenhäusern habe sich das Bild von prügelnden Beamtinnen gefestigt. Manchmal fällt sogar der Nebensatz, dass Betroffene für einen Aufenthalt in der Nordwache noch verhältnismäßig gut aussehen. Der nördlich des Dortmunder Hauptbahnhof gelegene Stadtteil gilt im Polzeijargon als „gefährlicher Ort“. Anlasslose Kontrollen, Racial Profiling, Razzien, sind an der Tagesordnung.
Die Initiative Defund the Police Dortmund fordert ein Ende der Diskriminierung und Unterdrückung durch die Polizeiarbeit in der Nordstadt, die Abschaffung von lebensgefährlichen Polizeiwaffen wie Tasern, und ein Ende der Kameraüberwachung, öffentliche Gelder zur Sicherstellung einer gesundheitlichen, sozialen, bildungs- und wohnungspolitischen Versorgung der Bevölkerung statt der Militarisierung der Polizei, ein multiprofessionelles Kriseninterventionsteam, Konzepte für Transformative Justice, die Solidarität und Selbstorganisation der Bewohner fördern und die Abschaffung der Wache Nord.
(mr)
Quellen: